
| Konzeption | Programm | Anmeldung | Veranstalter |
| ÜbersichtSektionenAbstractsReferenten |
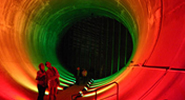   |
   |
Abstracts
Dr. Andreas Archut
· Prof. Dr. Paolo Brenni
· Prof. Dr. Jochen Brüning
· Prof. Dr. Ulrike Felt
· Christiane Götz-Sobel
· Prof. Dr. Jochen Hörisch
· Dr. Oliver Hochadel
· Volker Lange
· Armand Marie Leroi
· Prof. Dr. Wolfgang Mackens
· Dr. Wolfgang Merten
· Dr. Andrew Moore
· Simone Rödder / Miriam Voß
· Michael Seifert
· Prof. Dr. Thomas Schnalke
· Dr. Anke te Heesen
· Prof. Dr. Gerold Wefer
Dr. Andreas Archut
Flaschenpost vom Professor
Hochschulkommunikation im Nachrichtenmeer
Professoren sprechen am liebsten über ihre Forschung. Das ist gut für
Hochschulpressesprecher. Am liebsten sprechen Professoren darüber allerdings mit anderen
Professoren. Das ist schlecht für Hochschulpressesprecher. Denn unsere Aufgabe ist es,
zwischen der Welt der Wissenschaft und der "wirklichen" Welt zu vermitteln.In der Kommunikation mit den Medien stehen Hochschulen im Wettbewerb mit vielen anderen, die sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sichern wollen. Dabei sind die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit besser geworden: Mehr Menschen denn je interessieren sich für unsere Themen. Wissenssendungen und -seiten haben Konjunktur und einen riesigen Bedarf nach Themen. Diesen Bedarf zu bedienen, erfordert aber auch die Bereitschaft, sich den Regel der Medien zu unterwerfen. Dazu ist Wissenschaft leider oft nicht fähig und auch nicht immer bereit.
Wissenschaftskommunikation ist aber nur eine Aufgabe von vielen, die Hochschulpressestellen stemmen müssen. Universitäten sind komplexe Gebilde. Sie kommunizieren ständig mit den unterschiedlichsten Dialogpartnern: derzeitige und zukünftige Studierende, Mitarbeiter, Ehemalige, Freunde und Förderer, Kooperationspartner in Wissenschaft, Organisationen und Wirtschaft, Politiker und Journalisten. Die Ressourcen, die für die Kommunikation mit allen Zielgruppen zur Verfügung stehen, sind überschaubar.
Darum haben sich einige klassische Kommunikationswege herausgebildet (z.B. Pressemitteilungen, Magazine, Internet), die vergleichsweise kostengünstig sind, aber immer weniger bringen. Alleine über den Informationsdienst Wissenschaft gelangen heute täglich 50 bis 100 Pressemitteilungen pro Tag auf den Schirm der Redaktionen. Eine einzelne Pressemitteilung hat manchmal nicht viel mehr Aussicht auf Erfolg als die Flaschenpost eines Schiffbrüchigen.
Neben der klassischen Medienarbeit spielt aber auch die Wissenschaftskommunikation mit Eventcharakter im Austausch der Hochschulen mit der Öffentlichkeit eine immer wichtigere Rolle. Die Wissenschaftsnacht (übrigens eine Bonner Erfindung!) und die Kinderuni sind erfolgreiche Beispiele dafür, dass Events nicht notwendigerweise zum Preis von Niveauverlust zu haben sind. Sie zeigen aber auch die Grenzen des Machbaren auf. Und auch wenn es inzwischen gelingt, Zehntausende zu mobilisieren, so ist noch nicht klar, wie nachhaltig solche Aktionen wirklich sind.
Prof. Dr. Paolo Brenni
University Collections, Science Museums and Science Centres: What are they for?
At the beginning of the third millennium, science museums are trying to redefine their identity. Science centres, which until a few years ago seemed to be the ideal solution to all the problems related to “public understanding of science”, show nowadays all their limits and sometime risk to become a kind of amusement parks. In our age of increasing domestic use of computer (media, games, didactic tutorials, etc.) the technology of science centres displays is aging very fast, and their “hands-on” exhibits often tend to be used just as “touch and go” attractions. “Classical” technological and scientific museums struggle between the necessity of fulfilling their mission of preserving and studying historical artefacts and the need of being popular and attractive. Unfortunately in the last years several museums of this kind tent to copy the model of “science centres” and neglected the cultural potential of their collections. University museums were developed in the past for scholarly research as well as for didactic purposes. After WWII many university museums were neglected due to the changes of educational curricula and the transformation of scientific research. But recently many scientific collections belonging to universities were rediscovered and reordered. Today, these collections preserve an enormous number of natural specimen, models, scientific instruments, documents and artefacts. I do believe that university museums represent an enormous cultural wealth, which, if properly presented and explained, can be still be very useful. Historical artefacts preserved in universities collection can tell fascinating stories, if we are able to let them “speak”.
Prof. Dr. Jochen Brüning
Inszenierung tut not. Über die Erzeugung und Vermittlung von Wissen
Im Zentrum steht der Begriff der Inszenierung, dessen Rolle im Prozess der Wissenserzeugung und der Wissensvermittlung bestimmt werden soll. Gestützt auf eine Analyse des Wissensbegriffs vertrete ich die These, dass Wissenserzeugung und -vermittlung grundlegend miteinander verknüpft sind und, dass in dieser Verknüpfung Akte der Inszenierung eine fundamentale Rolle spielen. Entsprechend wichtig sind diese für Formen der Wissensvermittlung, die auf Synthesen zielen, also auf Überwindung von Befremdung oder Ablehnung, welche auf Nichtwissen beruhen.
Prof. Dr. Ulrike Felt
Wissenschaftskommunikation neu denken: Zur Repositionierung der Universität in einer Wissensgesellschaft
In vielen europäischen Ländern hat sich die Lage an den Universitäten in den letzten Jahren deutlich verändert. Mit Schlagworten wie Autonomie, Management, Effizienz oder Kundenorientierung wird versucht, der Universität einen neuen gesellschaftlichen Platz zuzuweisen. Nun wird gerade in dieser Phase der Neuverortung der Wissenschaftskommunikation zwar eine bedeutendere Rolle zugeschrieben, aber trotzdem – so meine These – wird diese in der Vielfalt ihrer Bedeutung noch immer weitgehend unterschätzt. WissenschaftlerInnen wird nahegelegt, stärker auf Medien zuzugehen, die Möglichkeiten der Kommunikation in geeigneter Weise aufzugreifen und sich so einen Platz für das eigene Feld (und bisweilen auch für sich) zu “erobern”. Dabei bleibt der Blick auf Wissenschaftskommunikation vielfach vor allem bei klassischen Medien hängen. Ich möchte mich deshalb mit den darüber hinaus gehenden Funktionen dieser Kommunikation auseinandersetzen, welche mir für die Gestaltung von Universität als Möglichkeitsraum ebenso wesentlich erscheinen. - Grenzüberschreitung und gleichzeitige Grenzziehung: Gerade in der Zeit, in der Universität zwar Autonomie zugesprochen wird, aber parallel dazu der Druck von außen steigt, gesellschaftliche Erwartungen zu erfüllen, erhält Wissenschaftskommunikation eine wesentliche neue Funktion. Neben der Tatsache, dass sie Grenzüberschreitungen, also das gesellschaftliche “Hineindenken” in Wissenschaft, aber auch provokantes “Querdenken” ermöglich, kann Wissenschaftskommunikation auch dazu beitragen, die Grenzen dessen, was machbar und wünschenswert ist, zu verdeutlichen. - Herstellung von Binnenöffentlichkeiten: Gerade in einer Zeit hoher Studierendenzahlen, einer Verschulung der Curricula und gebrochener Karriereverläufe scheint es wesentlich, wieder alternative Kommunikationsräume quer zu Fächern und Wissenskulturen innerhalb der Institution herzustellen. Studierende sollten, wenn sie die Universität verlassen, diese auch als in ihrer Vielfalt starke Forschungsinstitution wahrnehmen. - Raum, um sich mit Gesellschaft auf kollektive Denkexperimente einzulassen: Es gilt, Kommunikationsräume zu schaffen, in denen ein gemeinsames Denken mit WissenschaftlerInnen und VertreterInnen der Gesellschaft ermöglicht wird. Dabei wäre ein bewusstes Abrücken von überzogenen “Eventisierungsversuchen” zielführend.
Christiane Götz-Sobel
Wenn die Bilder laufen - Wissenschaft im Fernsehen
Was für Zuschauer interessant und spannend ist, bekommt von wissenschaftlicher Seite oftmals Prädikate wie oberflächlich, reißerisch, dem Thema nicht angemessen ... Mit Themen aus Wissenschaft und Technik ein Millionenpublikum erreichen zu wollen, heißt: es sich gelegentlich zwischen den Stühlen bequem zu machen. Denn: Sind Wissenschaftler mit der Darstellung ihres Fachgebiets rundum zufrieden, bedeutet das in der Regel: sie ist nicht mehr zuschauergerecht. Welche Möglichkeiten hat das Medium Fernsehen, wissenschaftliche Themen zu Inhalten von "Wissenssendungen" zu machen? Mit welchen Strategien ist ein großes Publikum zu gewinnen? Einblicke in den Alltag einer "Wissenssendungsredaktion".
Prof. Dr. Jochen Hörisch
Wie erfolgversprechend kommunizieren Geisteswissenschaftler?
"Richtige Wissenschaften" arbeiten mit künstlichen Sprachen, Zahlen und Sonderzeichen, Geister/swissenschaften bewegen sich im abgründigen Medium natürlicher Sprachen. Was nichts anderes heißt als dies: Rechenintensive Wissenschaften haben es mit Gleichungen zu tun, Geisteswissenschaften mit Gleichnissen und Vergleichen. Jeder auch nur halbwegs kundige Thebaner weiß, wenn er eine Formel wie x=y, a2+b2=c2 oder E=mc2 sieht, dass er es erstens mit wirklicher Wissenschaft und zweitens mit einer Gleichung zu tun hat, auf deren beiden Seiten dasselbe steht. Faszinierend ist an den mathematischen Gleichungen, dass diese Identität sich nicht sofort erschließt und dass dennoch weltweit und zu jeder Zeit dasselbe rauskommt, wenn Mathematiker Gleichungen nachrechnen. Wenn Geisteswissenschaften es heute sehr schwer haben, ihr Existenzrecht und ihren Anspruch auf Alimentierung plausibel zu machen, so hat das neben vielen anderen Gründen auch diesen einfachen Grund: Die Gleichnisse (Texte, Bilder, Töne, Dokumente, Nachrichten, Quellen etc.), mit denen sie sich beschäftigen, sind keine Gleichungen. Schlicht gesagt: Es kommt nicht dasselbe heraus, wenn Literaturwissenschaftler Goethes Faust, Theologen den Kreuzestod Christi, Bildwissenschaftler das Lächeln der Mona Lisa und Philosophen den Sinn des Daseins verstehen wollen. Viele Geisteswissenschaftler haben daraus eine allzu wohlfeile, politisch und kulturell korrekte, liberalfundamentalistische bis defätistische Konsequenz gezogen: Man könne dies oder jenes eben so oder so sehen und verstehen. Nun gut, das haben wir auch ohne Geisteswissenschaften schon geahnt, lautet zu Recht die gängige Antwort der auch nur einigermaßen hellen Zeitgenossen. Darauf kann man kommen, auch wenn man nicht die frühen Erwachsenenjahre in geisteswissenschaftlichen Vorlesungen, Seminaren, Kaffeehäusern und Bibliotheken verbracht hat. Wissenschaftspragmatisch heißt dies: Geisteswissenschaftliche Schulen befehden sich entweder systematisch oder eben gar nicht – soll heißen: man pflegt überspezialisiert seinen claim und sieht zu, dass man auf diesem überschaubaren Terrain eine bescheidene Diskurshoheit wahrt. Wehe, wenn da einer dreinredet. Ansonsten gilt die Parole: munteres bis gereiztes Durcheinanderreden. Kein Wunder, dass die Geisteswissenschaften insgesamt zumeist als das wahrgenommen werden, was sie sind: noise. Kurzum: für das negative Image der Geisteswissenschaften sind diese in erheblichem Maße selbst verantwortlich. Der Kern des Problems ist schnell ersichtlich: es gibt keine Einheit der Fächer, und das ist angesichts der vielen Geister auch gut so. Es gibt aber auch kaum mehr den Willen, gemeinsam Probleme zu fokussieren und zu lösen. Und das ist nicht gut so. Gibt es dennoch erfolgreiche Kommunikationsmöglichkeiten für Geisteswissenschaftler und wenn ja, welche?
Dr. Oliver Hochadel
Skills, Reflexion, Netzwerk. Der Wiener Universitätslehrgang für Wissenschaftskommunikation
Kommunizieren will gelernt sein, das gilt auch und insbesondere für die Wissenschaftskommunikation. In Österreich gab es bis vor wenigen Jahren in den Bereichen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschafts-PR nur Autodidakten. Einige dieser Autodidakten haben sich zusammengetan und 2002 den Universitätslehrgangs für Wissenschaftskommunikation (www.scimedia.at) aus der Taufe gehoben. Drei Ziele haben wir uns gesetzt: die handwerklichen Fähigkeiten des Schreibens zu vermitteln, zur Reflexion über das eigene Arbeiten anleiten und einen direkten Kontakt zur Praxis herzustellen und dadurch ein enges Netzwerk zu knüpfen. Im Vortrag sollen das Konzept und die Lehrinhalte des Universitätslehrgangs kurz vorgestellt sowie die Erfahrungen mit den ersten beiden Lehrgängen, die guten und die weniger guten, resümiert werden.
Volker Lange
Videos und Co: Wie lernt man, über das Web multimedial zu kommunizieren?
Das Internet ändert sich derzeit dramatisch. Waren Inhalte noch vor wenigen Jahren weitestgehend textbasiert, so werden derzeit Video- und Audioangebote immer wichtiger. Das liegt nicht zuletzt an den hohen Bandbreiten, die auch den normalen Nutzern inzwischen zur Verfügung stehen. Die natürliche Folge: Das Internet wird zunehmend multimedial. Fachleute sehen bereits voraus, dass es bald das klassische Radio und Fernsehen ablösen oder zumindest deutlich ergänzen wird. Wie kann man in der Wissenschaft auf solche Trends reagieren? Müssen und können Universitäten und Institute auf diesen Zug aufspringen? Wie aufwendig ist es, multimediale Inhalte zu erstellen und vor allem: Lohnt es sich überhaupt? An einigen Beispielen soll gezeigt werden, dass multimediale Kommunikation via Internet schon längst in der Wirklichkeit angekommen ist, vor allem – aber nicht nur – in den USA. Video- oder Audiofiles für die breite Öffentlichkeit zu produzieren ist keine Hexerei. Und es gibt Organisationen, die Ihnen bei der Erstellung und beim Vertrieb multimedialer Inhalte unter die Arme greifen können, zum Beispiel „wisskomm e.V." (www.wisskomm.de) in Berlin oder das Göttinger Leibniz-Institut „IWF Wissen und Medien gGmbH" (www.iwf.de).
Armand Marie Leroi Ph.D.
Science and Sensation on British TV
Continental colleagues often tell of how much they admire the rôle that science plays in British public life. They look at the Royal Society of London and the Royal Institution of Great Britain, David Attenborough and Richard Dawkins, NATURE and NEW SCIENTIST, the BBC and Channel 4 – and wonder why their own equivalents seem so anemic by comparison. Are they right to think so? Is the Anglo-American Model worth emulating? One London scientist has his doubts. Armand Marie Leroi has travelled to the depths of the British media, contemplated its dark heart, and returned - though not unscathed. Tonight he tells of what he has seen.
Prof. Dr. Wolfgang Mackens
Gelegenheit schafft Ingenieure - Das Schülerlabor
Wenngleich Wissenschaftssendungen und -Shows landesweit boomen, sind die Grundlagenfächer Mathematik und Physik in Schule und Öffentlichkeit weiter von untergeordnetem bis verschwindendem Interesse. Selbst Mathematiklehrern ist die enorme Bedeutung ihres eigenen Faches für den Wirtschaftsstandort Deutschland oft nicht geläufig, und es gelingt ihnen selten, Schülerinnen und Schüler - über den engen Kreis potentieller Studierender reiner Mathematik hinaus - für die Mathematik einzunehmen. Weil die Mathematik heute, u.a. über den allgegenwärtigen Einsatz von Computern, in fast allen Wissenschafts- und Wissensbereichen mit Vorteil eingesetzt werden kann und Mathematik und Physik insbesondere in den Ingenieurwissenschaften unabdingbar sind, ist das allgemeine Desinteresse nicht nur für die Existenz mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Fakultäten der Universitäten bedrohlich, es gefährdet vielmehr die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft insgesamt und damit unser aller Wohlergehen. Die Frage, ob "Wissenschaftskommunikation für die Universitäten relevant sei", erscheint in diesem Rahmen fast naiv, Wissenschaftskommunikation ist hier dringend erforderlich.Im Vortrag wird dargestellt, wie die Technische Universität Hamburg-Harburg (TUHH) in einem koordinierten Bündel von Aktionen (www.tuhh.de/schule) die praktische Bedeutung der MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik für die Gesellschaft und für jeden Einzelnen gleichermaßen an Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrerinnen und Lehrer und ihre Eltern zu vermitteln bemüht ist. Als besonders erfolgreich hat sich die Ein-richtung des DLR_School_Lab Hamburg (www.dlr-schoollab-hamburg.de) erwiesen, in dem die praktische Kraft von Mathematik und Physik über die Demonstration ihres Einsatzes u.a. beim Bau und Betrieb von Flugzeugen gezeigt wird. Auch ein nur eintägiger Aufenthalt in einem Schülerlabor kann von nachhaltig motivierender Wirkung sein, wenn unter fachkundiger Anleitung Experimente mit direktem Bezug zur ingenieurwissenschaftliche Praxis ausgeführt werden können. Derzeit sind weitere Labore für andere Themenbereich der Ingenieur-wissenschaften in der Planung.
Dr. Wolfgang Merten
Der Studiengang: Master of Science Communication and Marketing, TU Berlin
Wissenschaftsmarketing ist ein integraler Bestandteil der Trias, die durch Wissenschaftsmanagement und Wissenschaftskommunikation ergänzt wird. Sie ist ein Element der Wissenschaftskommunikation, das strategisches Denken mit operativen Befähigungen verbindet.Das Curriculum befähigt die Studierenden zur Analyse wissenschaftspolitischer Entwicklungen, zur Strategiebildung in Hochschulen und für wissenschaftliche Einrichtungen. Es vermittelt den Gebrauch der Handwerkszeuge, um Marketing professionell, zielgerichtet und erfolgreich umzusetzen.
Eine durch Exzellenzinitiativen, High-Tech-Strategie und Bolognaprozess geprägte Situation erfordert die Aneignung von Kompetenzen, wie sie in verwandter Weise bislang nur in der Wirtschaft verbreitet waren. Um den Wandlungsprozess der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen aktiv mitgestalten und beeinflussen zu können, ist es notwendig, dessen Elemente und seine voraussichtliche Verlaufsform zu analysieren und die jeweils angemessenen Aktivitäten vorzubereiten und durchzuführen.
Wenn Rankings und davon abgeleitete leistungsbezogene Mittelvergaben nicht als Zumutung, sondern als Entwicklungschance begriffen werden, ist die Voraussetzung für einen Vitalisierungsschub gegeben. Die traditionelle Organisation von F&E muss sich in dem Maße ändern, wie sich die Herausforderungen an Management und Kommunikation den Usancen der Wirtschaft annähern.
Wissenschaftsmarketing an der TU Berlin, aber auch Wissenschaftsmanagement an der Uni Bremen, der FH Osnabrück oder der Verwaltungsakademie Speyer, nehmen in je spezifischer Weise Maß, um eine adäquate Ausbildung für die künftigen Protagonisten zu gewährleisten.
Der Studiengang „Wissenschaftsmarketing“ an der TUB konzentriert sich dabei auf die Herausbildung einer Marketingkonzeption, die den ganz speziellen Erfordernissen der Wissenschaft gerecht wird. Die klassischen Instrumentarien eignen sich nur bedingt zur Übertragung auf die Wissenschaft. Das Curriculum unseres Studiengangs ordnet den „Werkzeugkasten“ neu und ergänzt ihn um originäre wissenschaftsspezifische Instrumentarien: Wissenschaftskampagnen, Markenbildung und – führung, Hochschulfundraising, Projektmanagement und – finanzierung, Kommunikationsstrategien und – methoden , Issues Management und Public Affairs/Lobbying, Public Relations, Wissenschaftsjournalismus.
Vielfach genügt es die vorhandenen Ressourcen neu zu ordnen und angemessen `aufzu-stellen´, doch brauchen wir auch die eigens ausgebildeten Kommunikatoren, die diesen Prozess initiieren, begleiten und unterstützen.
Unser Masterstudiengang muss daher besondere Anforderungen an die künftigen Studierenden stellen. Neben einer abgeschlossenen akademischen Ausbildung benötigen sie unbedingt Berufserfahrungen, um für die praxisnahe Ausbildung entsprechend sensibilisiert zu sein. Der Studiengang findet abends, d.h. in der Regel berufsbegleitend statt, damit die Berufstätigen auch Gelegenheit zur Teilnahme haben.
Unsere Dozenten kommen sowohl aus der Hochschullehre, als auch aus der Praxis der Hochschulverwaltung, aus Einrichtungen der großen Forschungsgemeinschaften, dem BMBF, den großen wissenschaftspolitischen Playern , aber vor allem auch aus der Praxis der Agenturen, die die wissenschaftskommunikativen Aufgaben meist umsetzen.
Da wir jährlich nur etwa 20 Studenten aus Berlin neu aufnehmen können, haben wir uns entschlossen, unser Studienangebot ab WS 07 auch als bundesweit studierbares Blended Learning Studium anzubieten.
Dr. Andrew Moore
Nicht jammern, sondern verstehen und nutzen!
Die Wissenschaft hat nur in den wenigsten öffentlichen Medien einen gesicherten Platz. Wie alle anderen Neuigkeiten müssen wissenschaftliche Entdeckungen für ihre Berichterstattung hart kämpfen: das ist der Mechanismus der freien Presse. Viele Wissenschaftler ärgern sich, wenn einer Minderheitenmeinung zuviel Gewicht verliehen wird, oder sogar Wissenschaft mit Politik vermischt wird. Anstatt sich zu beklagen, oder über Mechanismen zur Verbesserung der Medien zu philosophieren, sollten sich Wissenschaftler mit der Funktionsweise der Medien vertraut machen, eine neue Sprache lernen und eine andere Art der Kommunikation praktizieren. Einige Beispiele zeigen sehr deutlich wie zielstrebige Wissenschaftler ein äußerst kontroverses Argument in den öffentlichen Medien durchsetzen können (- sogar bis hin zu verfälschten Forschungsergebnissen.)Manch eine Mediengeschichte mag wohl die Frage aufwerfen "Können sie nicht vorsichtiger mit wichtigen Themen umgehen?" Eigentlich ist verantwortungsvoller Journalismus zu 99% die Regel. Wissenschaftsjournalisten arbeiten fast immer sorgfältig und gründlich. Aber Geschichten, die eine breitere Bedeutung annehmen, geraten schnell aus den Händen von Wissenschaftsjournalisten. Und solange es die Rolle der Medien ist, für breite Schichten der Gesellschaft interessante und relevante Themen aufzugreifen, wird politischer Journalismus keine besonders vorsichtige Berufung sein. Dazu sind sogenannte "unabhängige" Medien trotzdem von einem zahlenden Publikum abhängig und Profit ist immer im Visier des Chefredakteurs / Verlegers. Interessante Artikel brauchen für den allgemeinen Leser eine interessante und relevante Grundlage, und diese sollten schon Wissenschaftler selbst liefern. Darüber hinaus sollten etabliertere Wissenschaftlern sich, fast als Pflicht, mit sozialen, politischen Debatten und deren Berichterstattern befassen.
Zugegeben: Die Medien konstruktiv in Anspruch zu nehmen, ist kein leichter Schritt. Aber zumindest zeigen Umfragen unter jüngeren Wissenschaftlern in Europa, dass die große Mehrheit die Fähigkeit zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit für einen sehr wichtigen Aspekt ihrer Ausbildung als Wissenschaftler hält - sogar für noch wichtiger als Fähigkeiten in verwandten wissenschaftlichen Bereichen. Es wird nicht einfach sein, großflächig dieses Bedürfnis zu erfüllen: viele Professoren und Arbeitsgruppenleiter schmähen das Erwerben solcher Fähigkeiten als Zeitverschwendung. Es gilt geradezu als unmoralisch in Europa, seine Forschung für die Medien schmackhaft zu machen.
Medien-Kommunikations-Workshops wie die von EMBO kombinieren Einsichten in die Funktionsweise der Medien mit Rat und Übungen, und beinhalten immer Live-Interviews mit Journalisten nach dem Motto: nur durch Tun versteht man eine Sache. Teilnehmer des Workshops sollten sich danach in der Lage fühlen, proaktiv mit Journalisten zu arbeiten - d.h. nicht zu warten bis sie von einem Journalisten angesprochen werden, sondern die Initiative selbst ergreifen, die Zeitung anzuschreiben oder anzurufen, um ihre Geschichte zu erzählen. Proaktives Verhalten der Wissenschaftler ist der wichtigste Beitrag zu einer ausgewogenen und akkuraten Berichterstattung.
Provozierend könnte man behaupten: Ohne proaktive Kommunikation wird es in Zukunft keine öffentlichen Gelder für die Forschung mehr geben. Angesichts der schweizerischen Genschutzinitiative - die ohne das aktive öffentliche Auftreten vieler Biologen definitiv gegen die Wissenschaft ausgefallen wäre - besteht eine große Gefahr für einzelne Forschungsbereiche.
Simone Rödder / Miriam Voß
Erreicht die Wissenschaftskommunikation das, was sie erreichen soll?
Initiativen zur Wissenschaftskommunikation sind als Reaktion auf sehr unterschiedliche Problemfelder des Verhältnisses der Wissenschaft zu ihrer Umwelt entstanden. Sie sind entsprechend vielfältig. Ein Vergleich von Wissenschaftskommunikationsformaten auf internationaler Ebene zeigt, dass einzelne deutsche Formate in Europa eine Vorreiter-Rolle haben, z.B. die Wissenschaftsjahre, die Stadt der Wissenschaft oder die Kinder-Uni. Zugleich wird deutlich, dass es kein Patentrezept für den Erfolg von Wissenschaftskommunikation gibt. In der Beurteilung verschiedener Formate der Wissenschaftskommunikation ist zwischen ihrer normativen Leistungsfähigkeit, d.h. den selbst gesetzten Zielen, und der empirischen Leistungsfähigkeit, d.h. den tatsächlich erreichten Ergebnissen, zu unterscheiden. In Bezug auf die normative Leistungsfähigkeit lassen sich vier Hauptziele identifizieren – Wissensvermittlung, Nachwuchsförderung/Edukation, Partizipation und Wissenschaft als kulturelle Aktivität/Unterhaltung. Verlässliche Aussagen über die empirische Leistungsfähigkeit zu treffen, ist bislang schwierig, weil Effekte der verschiedenen Formate nur schwer zu messen sind. Dies gilt in besonderem Maße für langfristige Wirkungen. Es lassen sich jedoch Faktoren benennen, die Projekte geeigneter oder weniger geeignet erscheinen lassen, die an sie gestellten Leistungserwartungen zu erreichen. Anhand zweier Beispielprojekte mit universitärem Bezug werden Stärken-Schwächen-Profile vorgestellt und daraus zentrale Leitlinien zukünftiger Wissenschaftskommunikation entwickelt.
Michael Seifert
„Epidemie Kinder-Uni" – Was bringt sie wirklich?
Das Bild einer Epidemie gibt die Ausbreitung einer erfolgreichen Innovation im Bereich Wissenschaftskommunikation treffend wieder. Im Juli 2002 wurde die Kinder-Uni als Gemeinschaftsprojekt der Eberhard Karls Universität Tübingen und der Zeitung "Schwäbisches Tagblatt" „erfunden“ und mit acht Vorlesungen erfolgreich erstmals durchgeführt. Im Mai 2003 gab es immer noch nur die Tübinger Kinder-Uni (und im Verborgenen etwas Ähnliches an der Universität Innsbruck), aber dann folgte Schlag auf Schlag eine Kinder-Uni-Neugründung nach der nächsten. Eine erste Kinder-Uni-Konferenz im März 2004 fand auf Einladung der Körber-Stiftung in Hamburg statt. Heute schätzt man die Zahl der Kinder-Unis auf nahezu 100 im deutschsprachigen Raum. Das Referat versucht der Frage nachzugehen, was Kinder-Uni eigentlich bringt. Es werden Antworten aus verschiedenen Perspektiven präsentiert: die von erziehungswissenschaftlichen Kritikern, die von Politikern, die von den Machern selbst (unter denen ich eine kleine Umfrage durchgeführt habe) und schließlich: die Kinder-Uni im Spiegel wissenschaftlicher Publikationen und Abschlussarbeiten. Lokale Weiterentwicklungen des klassischen Kinder-Uni-Konzepts werden aufgezeigt. Die Frage nach der Zukunft des Modells Kinder-Uni und damit nach dem Ende der Epidemie bleibt offen.
Prof. Dr. Thomas Schnalke
Auf Leben und Tod. Ausstellen im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité
Das Berliner Medizinhistorische Museum ist eine Einrichtung des größten Universitätsklinikums Europas, der Charité. Bekannt für die öffentliche Präsentation seiner Sammlung pathologisch-anatomischer Präparate, bietet es seinen Besuchern einen ‚Gang unter die Haut’. In seinen Sonderausstellungen wird die Medizin in ihrem breiten wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext vorgestellt, erläutert und kommentiert. Es geht dabei etwa um die Geschichte der Medizin, ihre Verbindung zu Kunst, Politik und Religion, immer wieder aber auch um ihre Angebote für die Zielgruppe jedes medizinischen Handelns und Denkens – den Kranken. Das Museum und seine Mitarbeiter verstehen die Praxis des Ausstellens als ein besonderes Publikationsformat im Spektrum akademischer Ausdrucksformen. So gesehen gibt es immer wieder Ausstellungen, die sehr wissenschaftlich sind, während andere sehr populär agieren. In meinem Beitrag umreiße ich die Spezifik der Arbeiten mit Objekten im medizin(histor)ischen Ausstellungsraum. Gleichzeitig plädiere ich für eine höhere Wertschätzung des musealen Arbeitens im universitären Raum.
Dr. Anke te Heesen
Forschung, Lehre, Schau: Zum Konzept des Museums der Universität Tübingen
Infolge der rasanten (natur-)wissenschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre ist die Sensibilität für die historischen Sachzeugen gestiegen. So werden ausgestopfte Vögel nicht länger bloß als Anschauungseinheit innerhalb des Erstsemesterstudiums der Biologie verstanden, sondern auch als Zeugen für die Praktiken früherer Wissensvermittlung, für die Techniken der Präparation und letztlich für die Vorstellung des Menschen und Wissenschaftlers von der zu erforschenden Natur gesehen. Inwieweit haben uns solche Vorstellungen in der Art und Weise Wissenschaft zu betreiben geprägt? Und worin liegt das Faszinierende der zum Teil schon obsolet gewordenen akademischen Materialkultur? Können sie einen vertieften Einblick in die historische wie aktuelle Wissenschaftskultur vermitteln? Solche Fragen stehen zu Beginn der Auseinandersetzung des neu einzurichtenden Museums der Universität Tübingen. Im Vortrag wird dessen Konzept skizziert und anhand einer aktuellen Ausstellungsplanung beispielhaft vertieft.
Prof. Dr. Gerold Wefer
Wissenschaft im Dialog – Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Eine Bilanz
Das vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Jahr 1999 initiierte und organisierte Symposium „Public Understanding of the Sciences and Humanities“ (PUSH) gab wichtige Impulse und Anstöße für den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Am Ende des Workshops unterzeichneten die in Deutschland führenden Wissenschaftsorganisationen ein Memorandum und gründeten damit die Initiative „Wissenschaft im Dialog (WiD)“. Die zentralen Veranstaltungen von WiD sind sehr eng verknüpft mit den seit dem Jahr 2000 durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgerufenen Wissenschaftsjahren. Ziel und Aufgabe der Initiative Wissenschaft im Dialog ist es, Bevölkerung und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen miteinander ins Gespräch zu bringen. Hierzu hat WiD Plattformen wie z. B. den Wissenschaftssommer geschaffen. Für den Dialog mit der Bevölkerung wurden von WiD unterschiedliche, zielgruppenspezifische Veranstaltungsformate für alle Altersgruppen entwickelt, z. B. für Kinder, Schüler und Jugendliche sowie Erwachsene. Ein Ziel von WiD ist es auch, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu motivieren, noch mehr als bisher auf die Bevölkerung zuzugehen. WiD unterstützt sie dabei, ihr Wissen und ihre Erkenntnisse für ein breites Publikum verständlich aufzubereiten sowie interessant und ansprechend zu vermitteln. Ziel ist es zudem, auch Forscher und Forscherinnen unterschiedlicher Fachgebiete miteinander ins Gespräch zu bringen und sie zu motivieren, gemeinsam komplexe Zusammenhänge der Bevölkerung zu vermitteln. Vor dem Hintergrund jährlich steigender Ausgaben für Wissenschaft und Forschung gewinnt die Wissenschaftskommunikation zunehmend an Gewicht. Die (Teil-)Öffentlichkeiten sind darüber zu informieren, welche Leistungen und Wertschöpfungen mit jenen Steuermilliarden erbracht werden, die alljährlich in Forschung und Lehre fließen. Zudem wurde Wissenschaft und Forschung in den vergangenen Jahren von der Politik eine immer größere Problemlösungskompetenz im Hinblick auf drängende gesellschaftspolitische Fragen zuerkannt. Dieser Vertrauensvorschuss von Politik und Gesellschaft kann nur legitimiert werden, wenn auch weiterhin und möglichst verstärkt Forschungsergebnisse auf verständliche Art und Weise der Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Zukünftiges Ziel von WiD ist die Weiterentwicklung zu einem bundes- und europaweit wahrnehmbaren und aktionsfähigen Kompetenzzentrum der Wissenschaftskommunikation. Die Zielgruppenansprache wird zukünftig noch stärker differenziert. Die Formate werden stärker auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten, eine generelle Abkehr von der „breiten“ Öffentlichkeit soll es aber nicht geben. WiD wird zukünftig häufiger als bisher versuchen, aktuelle und strittige Forschungsfragen aufzugreifen. Dazu bietet sich z. B. das Format der Konsensus-Konferenzen an. Dem BMBF wird vorgeschlagen, nach dem Jahr der Mathematik in 2008 in den darauf folgenden Jahren nicht mehr Disziplinen, sondern Themenfelder in den Mittelpunkt der Aktionen zu stellen. Diese könnten sich an Themen der High-Tech-Strategie der Bundesregierung orientieren. Dem BMBF werden für die nächsten Wissenschaftsjahre folgende Themen vorgeschlagen: Klima, Gesundheit, Energie.| Kontakt | Anfahrt | Impressum |
