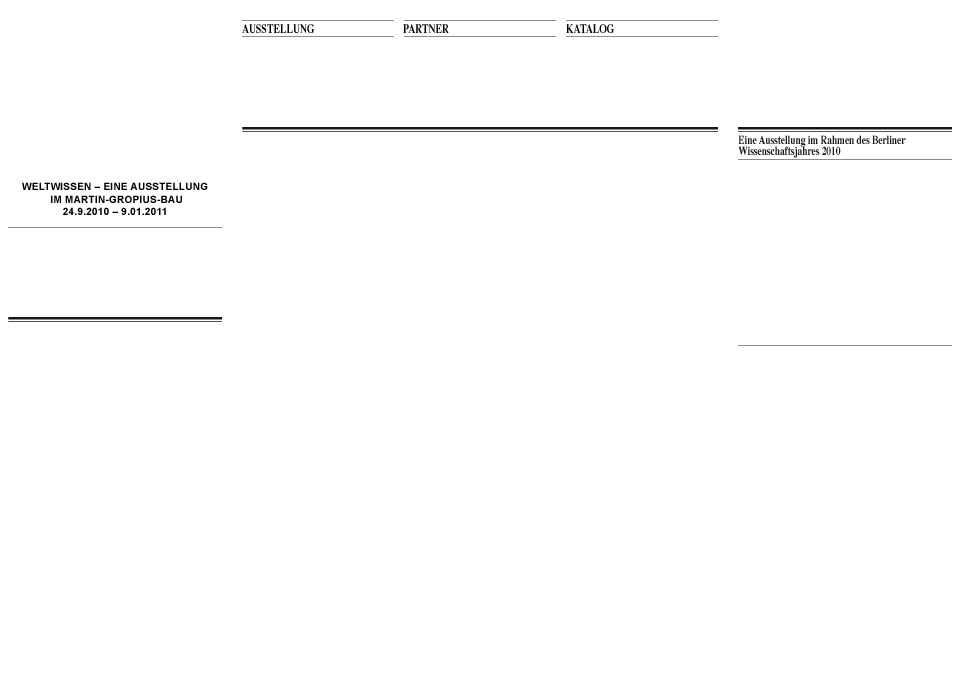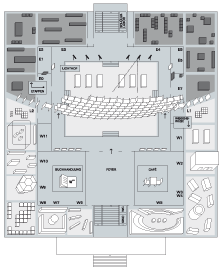Hintergrund
Die Auswahl und Anordnung der Objekte nahm der US-amerikanische Künstler Mark Dion vor. Dion lebt in New York. Seine Arbeiten befassen sich regelmäßig mit der Geschichte unseres Umgangs mit der Natur. Dions künstlerische Tätigkeit führt ihn regelmäßig rund um den Globus. Werke von ihm waren unter anderem in Ausstellungen in Berlin, Caracas, Hamburg, Köln, London, Mailand, New York, Paris, Rio de Janeiro, Sabah, Sydney, Tokio, Warschau und Wien zu sehen.
Mark Dion, geb. 1961 in Bedford, Massachusetts | Foto: Rosa Benz | WeltWissen
"Mein Atelier ist der Flohmarkt!"
Ein Gespräch über Wunderkammern, Lautsprecher und den größten Pflanzensamen der Welt mit dem amerikanischen Künstler Mark Dion.Wie gefällt es Ihnen an Ihrem neuen Arbeitsort Berlin?
Sehr beeindruckend: Es ist eine unglaublich kosmopolitische Stadt geworden. Geht man durch die Berliner Straßen, hört man koreanisch, japanisch, französisch, englisch, italienisch, deutsch - da bekommt man eine gute Vorstellung einer Weltstadt. Höchstens in Amsterdam habe ich mich vielleicht einer derart offenen internationalen Situation ähnlich nahe gefühlt, die als Drehscheibe der verschiedenen Ideen und Kulturen funktioniert. Die Jugendkulturen, die Kunstszene, die Ausstellungen und die Wissenschaften - und es ist besonders interessant, hier im Gropiusbau zu arbeiten, wo ich bereits im letzten Jahr an einer Ausstellung beteiligt war. Die unglaubliche Beliebtheit der Ausstellungen, die sich über die verschiedensten sozialen Milieus
verteilt - nicht nur Touristen, junge Leute oder alte, sondern eine bunte Mischung.
Was sind ihre Lieblingsobjekte in der Installation und woher stammen sie?
Die Ausstellung ist in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Sammlungen und Fakultäten entstanden - von denen übrigens einige einen äußerst formellen Umgang pflegen. Manche der Exponate sind schlichte Lehrmittel, die irgendwo in Büros hinterlassen und auf höchst unordentliche Weise aufbewahrt worden sind. Ich habe sie in Schränken und auf Dachböden gefunden. Die ausgestellten Herbarium-Blätter beispielsweise finde ich sehr interessant - normalerweise handelt es
sich dabei ja um eine Ansammlung gepresster Pflanzen, doch manche sind dafür einfach zu kräftig. Schlicht unmöglich. Doch offensichtlich halten wir an der Idee fest, sie auf Papier zu befestigen - auch wenn sie von sehr großen Palmen stammen. Sie kommen genau wie die Lehrmaterialien und die Landkarten aus dem Botanischen Museum. Ein Raum, der voller Schätze des 19. und 20. Jahrhunderts ist. Modelle, Holzproben, getrocknete Pflanzensamen und so weiter. Eine unglaubliche Ansammlung! Der größte Samen der Welt, der der Palme, ist auch vertreten. Und seine leicht obszöne Anmutung verleiht ihm eine gewisse Komik.
Dazu faszinieren mich einige der medizinischen Apparaturen aus der Charité, die zu lagern bestimmt nicht einfach war. Einige davon werden übrigens in den Bahnbögen aufbewahrt. Man betritt also die großen Räume unter Backsteinbögen und begegnet darin den letzten hundert Jahren Geschichte der Apparatemedizin: Die eiserne Lunge und der Brutkasten aus den späten Vierziger, frühen Fünfziger Jahren. Ebenfalls sehr gut gefällt mir aber auch ein Fernseher aus der Sammlung des Technischen Museums - genauso wie eine Sammlung antiker Keramiken, die in dieser Art derzeit nicht in Berlin zu sehen sind. Oder Aufnahmen aus dem Lautarchiv, die verschiedene Dialekte dokumentieren. Sie sind zur Zeit des ersten Weltkrieges in einem Gefängnis entstanden – mit den Gefangenen als Sprachversuchsobjekten. Diese Aufnahmen sind heute von unschätzbarem Wert, da es sich um die Frühzeit der Aufnahmetechnologie handelt. Dazu stammen die Gefangenen von überall her: Irland, Schottland, Wales, England und Frankreich. Doch diese Auswahl ist, wie man an der an den Globus erinnernden Struktur der Ausstellungsarchitektur erkennt, nicht das Ende der Geschichte. Das ist mir sehr wichtig.
Was ist der Sinn dieser Kombination scheinbar disparater Objekte?
In der Zusammenstellung zeigt sich die eigentliche Stärke der Arbeit: Ein überwältigendes visuelles Spektakel, das einem die materielle Seite der Wissenschaftskultur zeigt. Wir pflegen uns Wissenschaftsgesichte als Ideengeschichte vorzustellen, doch als Bildhauer stelle ich mir Wissenschaft eher als Ansammlung verschiedener Dinge und ihrer Geschichte vor. Schließlich müssen die Ideen ja ihre physische Repräsentation in Objekten finden – weswegen die Installation auch als Einführung in die restliche Ausstellung gedacht ist. Gleichzeitig kann der Besucher aber auch aus einigen dieser Würfel mehr erfahren – beim Blick durch speziell dafür programmierte Teleskope werden ihm weitere Informationen präsentiert – zum Beispiel über des Kaisers Pferd, dessen Skelett sowohl seinen Platz in der Wissenschaftsgeschichte als auch in der Geschichte der politischen Ökonomie hat. So funktionieren viele dieser Objekte, die eben auch die Sammlungen, denen sie entstammen, repräsentieren.
Wir sehen also eigentlich eine Sammlung von Sammlungen?
Genauer gesagt sehen wir eine Art Index. Und so bin ich auch an diese Aufgabe gekommen: Zwischen dem Team, das die Ausstellung produziert und dem Team der Ausstellungsarchitekten gab es die Idee, diese Konstruktion eines Kabinetts zu entwickeln. Doch dann standen sie vor dem Problem, dass sie mit einem Haufen ganz unterschiedlicher Disziplinen zu tun hatten. Die Kuratoren der eigentlichen Ausstellung waren als Historiker ihrer Disziplinen wie Medizin oder Physik sehr mit der Arbeit an ihren eigenen Ausstellungsräumen befasst, die Architekten planten den Bau – wer sollte nun für den Inhalt sorgen? Das war die große Frage.
Eine weitere Frage wäre, wo denn jetzt genau die Kunst ins Spiel kommt ...
Das zu beschreiben ist sehr komplex. Es gab eingangs zwei Fragen: Womit füllen wir es und wie werden diese Dinge dann arrangiert. Das von Wissenschaftshistorikern klären zu lassen, war nicht so einfach. Ich habe dann diesen Auftrag sehr dankbar in dem Wissen angenommen, dass ein Großteil meiner Arbeit darin bestünde, einige der bemerkenswertesten Sammlungen dieser Welt zu durchsuchen – Sammlungen, zu denen die Öffentlichkeit nur begrenzten Zugang hat. Wie sollte das nun organisiert sein – zufällig oder systematisch? Ich habe mich dann dafür entschieden, ein Drittel den Naturwissenschaften zu überlassen und sie nach aristotelischem Prinzip zu organisieren. Eine ununterbrochene aufsteigende Linie der Komplexität, beginnend bei der in diesem Fall durch die Landkarte eines Gebirges dargestellten inorganischen Welt über Gesteine zu Fossilien und zu einfachen Pflanzen, wirbellose Tieren und so weiter – bis zum Menschen. Die nächste Kategorie ist dann der Mensch – sowohl als Objekt der Medizin als auch als Produzent von Kultur, wie er in ethnographischenen Sammlungen dargestellt wird. Jeder Kontinent wird von einer menschlichen Gestalt und einem Gefäß repräsentiert. Und natürlich die abstrakten Disziplinen: Linguistik, Geschichte, Philosophie, Physik, Chemie, Mathematik.
In der Zusammenstellung zeigt sich die eigentliche Stärke der Arbeit: Ein überwältigendes visuelles Spektakel, das einem die materielle Seite der Wissenschaftskultur zeigt. Wir pflegen uns Wissenschaftsgesichte als Ideengeschichte vorzustellen, doch als Bildhauer stelle ich mir Wissenschaft eher als Ansammlung verschiedener Dinge und ihrer Geschichte vor. Schließlich müssen die Ideen ja ihre physische Repräsentation in Objekten finden – weswegen die Installation auch als Einführung in die restliche Ausstellung gedacht ist. Gleichzeitig kann der Besucher aber auch aus einigen dieser Würfel mehr erfahren – beim Blick durch speziell dafür programmierte Teleskope werden ihm weitere Informationen präsentiert – zum Beispiel über des Kaisers Pferd, dessen Skelett sowohl seinen Platz in der Wissenschaftsgeschichte als auch in der Geschichte der politischen Ökonomie hat. So funktionieren viele dieser Objekte, die eben auch die Sammlungen, denen sie entstammen, repräsentieren.
Wir sehen also eigentlich eine Sammlung von Sammlungen?
Genauer gesagt sehen wir eine Art Index. Und so bin ich auch an diese Aufgabe gekommen: Zwischen dem Team, das die Ausstellung produziert und dem Team der Ausstellungsarchitekten gab es die Idee, diese Konstruktion eines Kabinetts zu entwickeln. Doch dann standen sie vor dem Problem, dass sie mit einem Haufen ganz unterschiedlicher Disziplinen zu tun hatten. Die Kuratoren der eigentlichen Ausstellung waren als Historiker ihrer Disziplinen wie Medizin oder Physik sehr mit der Arbeit an ihren eigenen Ausstellungsräumen befasst, die Architekten planten den Bau – wer sollte nun für den Inhalt sorgen? Das war die große Frage.
Eine weitere Frage wäre, wo denn jetzt genau die Kunst ins Spiel kommt ...
Das zu beschreiben ist sehr komplex. Es gab eingangs zwei Fragen: Womit füllen wir es und wie werden diese Dinge dann arrangiert. Das von Wissenschaftshistorikern klären zu lassen, war nicht so einfach. Ich habe dann diesen Auftrag sehr dankbar in dem Wissen angenommen, dass ein Großteil meiner Arbeit darin bestünde, einige der bemerkenswertesten Sammlungen dieser Welt zu durchsuchen – Sammlungen, zu denen die Öffentlichkeit nur begrenzten Zugang hat. Wie sollte das nun organisiert sein – zufällig oder systematisch? Ich habe mich dann dafür entschieden, ein Drittel den Naturwissenschaften zu überlassen und sie nach aristotelischem Prinzip zu organisieren. Eine ununterbrochene aufsteigende Linie der Komplexität, beginnend bei der in diesem Fall durch die Landkarte eines Gebirges dargestellten inorganischen Welt über Gesteine zu Fossilien und zu einfachen Pflanzen, wirbellose Tieren und so weiter – bis zum Menschen. Die nächste Kategorie ist dann der Mensch – sowohl als Objekt der Medizin als auch als Produzent von Kultur, wie er in ethnographischenen Sammlungen dargestellt wird. Jeder Kontinent wird von einer menschlichen Gestalt und einem Gefäß repräsentiert. Und natürlich die abstrakten Disziplinen: Linguistik, Geschichte, Philosophie, Physik, Chemie, Mathematik.
Das klingt aber noch nicht nach Kunst, sondern eher nach Bürokratie: Recherchieren und Formulare ausfüllen, Genehmigen einholen, et cetera. Wo bleibt das Subjektive, wo sind die Farbflecken auf der Hose?
Nun ja, ich bin kein großer Bohemien. Oder nur auf gewisse Weise. Menschen werden aus den verschiedensten Gründen Künstler. Manche machen gerne Sachen. Schmutzige Hände, Farbreste, Ton – das befriedigt viele Künstler, aber nicht mich. Ich ziehe daraus kein sonderliches Vergnügen, nicht einmal aus meiner Bildhauerei oder meinen Zeichnungen. Das sind einfache Hilfsmittel, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Meine Auseinandersetzung mit Kunst ist immer die Auseinandersetzung mit Ideen. Darin liegt mein Vergnügen. Wie stelle ich unglaublich vielschichtige Ideen so dar, dass sie einerseits berühren und dennoch nichts an Komplexität verlieren? Wie arbeite ich so mit Objekten, dass sie inspirierende Geschichten erzählen? Von daher ist es für mich das perfekte Projekt. Auch als Bildhauer re-kombiniere ich zumeist existierende Objekte – mein Atelier ist eigentlich der Flohmarkt. In diesem Fall die Sammlungen der Universitäten und der wissenschaftlichen Museen geöffnet zu bekommen ist für mich einfach eine unglaubliche Gelegenheit. Damit würde ich gerne jeden Tag arbeiten.
Liegt die Faszination für diese Objekte auch in ihrer sozusagen auch dem Laien zugänglichen Aura begründet, wie man sie heute im Zeitalter der hochspezialisierten Forschung selten findet?
Nun ja – in erster Linie ist es eine idiosynkratische Auswahl. So gut wie kein Plastik. Und ich bin hier ja nicht als Illustrator eingeladen worden, sondern als Künstler. Hätte man mich gebeten, dies und das einfach nur darzustellen, wäre das ganz gewiss eine andere Arbeit geworden. Statt dessen habe ich mich entschieden, die materielle Seite der Wissenschaften durch meine Optik gesehen zu repräsentieren. Und mein Blick entstammt dem 19. Jahrhundert. Der Moment, in dem die Grundlagen für die Fragen der nächsten zweihundert Jahre geschaffen werden. Davon fühle ich mich persönlich stark angezogen. Dazu interessiert mich natürlich auch der ganzheitliche Aspekt, in dem Forscher und Künstler eine Person und nicht eine Anzahl verschiedenster Spezialisten sind. Die aktuelle Sehnsucht, die es jetzt in der Kultur danach und nach physischen Objekten gibt, hat damit zu tun, dass wir inzwischen alles vor dem Bildschirm erledigen. So erklärt sich auch der Erfolg von Museen. Dann haben mich natürlich auch schwer zugängliche Objekte interessiert, die in Sammlungen versteckt sind. Dazu gehört natürlich auch die Begegnung mit ungewöhnlichen Orten und ungewöhnlichen Menschen – die es mir manchmal nicht ganz leicht gemacht haben.
Ist der Vergleich Ihrer Arbeit mit den historischen Wunderkammern zulässig?
Ja, insofern als dass auch diese entlang bestimmter kosmologischer Systeme aufgestellt waren und eine gewisse Sicht auf die Welt verkörperten. Hermetische Tradition, alchemistische Tradition – Sammlungen, in denen das Objekt nicht Ding an und für sich ist, sondern etwas Größeres darstellt. Nach diesem Schema funktioniert die Arbeit: Jedes Objekt repräsentiert eine Sammlung, die wiederum eine bestimmte Weltsicht repräsentiert. Deswegen heißen unsere Universitäten ja auch Universitäten – wegen der Beziehung zum Universum. In der alchemistischen Tradition zwischen Mikro- und Makrokosmos spielen diese frühen Museen eine große Rolle, aus denen sich dann die Museen der Aufklärung und die großen öffentlichen Museen entwickeln. Es geht um den proto-wissenschaftlichen Moment.
Lassen sich die Objekte auch einer analytischen Lektüre unterziehen?
Nun – für mich entfalten die Dinge ihre eigentliche Bedeutung im Dialog der unterschiedlichsten Objekte, der durchaus unerwartet sein kann. Man denke nur an die Surrealisten, die ebenfalls von alten Museen fasziniert waren. Deswegen habe ich auch viele Objekte, insbesondere in dem der Technik gewidmeten Teil, ausgewählt, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Oder ich habe sie so präsentiert, wie man sie nicht sofort erkennen würde: Ein Lautsprecher, der auf dem Kopf steht. Oder eine Flaschenverschlussmaschine, die als Maschine bemerkenswert ist und eine fantastische Lektüre anbietet. Diese Dinge sollen mehr als illustrieren – sie sollen Menschen öffnen.
Ist Ihnen als Nordamerikaner bei der Recherche irgendetwas an den Sammlungen „deutsch“ vorgekommen?
Nein, abgesehen von der Begeisterung für Büsten: So eine Art akademischer Personenkult – hier haben wir die Büste des Gründers der historischen Fakultät! Ansonsten ist das Erfolgsgeheimnis der Sprache der Wissenschaft ihre Internationalität. Oft werde ich gefragt, wie ich als Amerikaner mit einer nur zweihundertjährigen Geschichte mich für diese Dinge begeistern kann. Dazu kann ich nur sagen, dass die Geschichte meiner Bildung da anfängt, wo auch die Geschichte der europäischen Bildung beginnt.
Interview: Gunnar Luetzow
Nun ja, ich bin kein großer Bohemien. Oder nur auf gewisse Weise. Menschen werden aus den verschiedensten Gründen Künstler. Manche machen gerne Sachen. Schmutzige Hände, Farbreste, Ton – das befriedigt viele Künstler, aber nicht mich. Ich ziehe daraus kein sonderliches Vergnügen, nicht einmal aus meiner Bildhauerei oder meinen Zeichnungen. Das sind einfache Hilfsmittel, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Meine Auseinandersetzung mit Kunst ist immer die Auseinandersetzung mit Ideen. Darin liegt mein Vergnügen. Wie stelle ich unglaublich vielschichtige Ideen so dar, dass sie einerseits berühren und dennoch nichts an Komplexität verlieren? Wie arbeite ich so mit Objekten, dass sie inspirierende Geschichten erzählen? Von daher ist es für mich das perfekte Projekt. Auch als Bildhauer re-kombiniere ich zumeist existierende Objekte – mein Atelier ist eigentlich der Flohmarkt. In diesem Fall die Sammlungen der Universitäten und der wissenschaftlichen Museen geöffnet zu bekommen ist für mich einfach eine unglaubliche Gelegenheit. Damit würde ich gerne jeden Tag arbeiten.
Liegt die Faszination für diese Objekte auch in ihrer sozusagen auch dem Laien zugänglichen Aura begründet, wie man sie heute im Zeitalter der hochspezialisierten Forschung selten findet?
Nun ja – in erster Linie ist es eine idiosynkratische Auswahl. So gut wie kein Plastik. Und ich bin hier ja nicht als Illustrator eingeladen worden, sondern als Künstler. Hätte man mich gebeten, dies und das einfach nur darzustellen, wäre das ganz gewiss eine andere Arbeit geworden. Statt dessen habe ich mich entschieden, die materielle Seite der Wissenschaften durch meine Optik gesehen zu repräsentieren. Und mein Blick entstammt dem 19. Jahrhundert. Der Moment, in dem die Grundlagen für die Fragen der nächsten zweihundert Jahre geschaffen werden. Davon fühle ich mich persönlich stark angezogen. Dazu interessiert mich natürlich auch der ganzheitliche Aspekt, in dem Forscher und Künstler eine Person und nicht eine Anzahl verschiedenster Spezialisten sind. Die aktuelle Sehnsucht, die es jetzt in der Kultur danach und nach physischen Objekten gibt, hat damit zu tun, dass wir inzwischen alles vor dem Bildschirm erledigen. So erklärt sich auch der Erfolg von Museen. Dann haben mich natürlich auch schwer zugängliche Objekte interessiert, die in Sammlungen versteckt sind. Dazu gehört natürlich auch die Begegnung mit ungewöhnlichen Orten und ungewöhnlichen Menschen – die es mir manchmal nicht ganz leicht gemacht haben.
Ist der Vergleich Ihrer Arbeit mit den historischen Wunderkammern zulässig?
Ja, insofern als dass auch diese entlang bestimmter kosmologischer Systeme aufgestellt waren und eine gewisse Sicht auf die Welt verkörperten. Hermetische Tradition, alchemistische Tradition – Sammlungen, in denen das Objekt nicht Ding an und für sich ist, sondern etwas Größeres darstellt. Nach diesem Schema funktioniert die Arbeit: Jedes Objekt repräsentiert eine Sammlung, die wiederum eine bestimmte Weltsicht repräsentiert. Deswegen heißen unsere Universitäten ja auch Universitäten – wegen der Beziehung zum Universum. In der alchemistischen Tradition zwischen Mikro- und Makrokosmos spielen diese frühen Museen eine große Rolle, aus denen sich dann die Museen der Aufklärung und die großen öffentlichen Museen entwickeln. Es geht um den proto-wissenschaftlichen Moment.
Lassen sich die Objekte auch einer analytischen Lektüre unterziehen?
Nun – für mich entfalten die Dinge ihre eigentliche Bedeutung im Dialog der unterschiedlichsten Objekte, der durchaus unerwartet sein kann. Man denke nur an die Surrealisten, die ebenfalls von alten Museen fasziniert waren. Deswegen habe ich auch viele Objekte, insbesondere in dem der Technik gewidmeten Teil, ausgewählt, die sich nicht auf den ersten Blick erschließen. Oder ich habe sie so präsentiert, wie man sie nicht sofort erkennen würde: Ein Lautsprecher, der auf dem Kopf steht. Oder eine Flaschenverschlussmaschine, die als Maschine bemerkenswert ist und eine fantastische Lektüre anbietet. Diese Dinge sollen mehr als illustrieren – sie sollen Menschen öffnen.
Ist Ihnen als Nordamerikaner bei der Recherche irgendetwas an den Sammlungen „deutsch“ vorgekommen?
Nein, abgesehen von der Begeisterung für Büsten: So eine Art akademischer Personenkult – hier haben wir die Büste des Gründers der historischen Fakultät! Ansonsten ist das Erfolgsgeheimnis der Sprache der Wissenschaft ihre Internationalität. Oft werde ich gefragt, wie ich als Amerikaner mit einer nur zweihundertjährigen Geschichte mich für diese Dinge begeistern kann. Dazu kann ich nur sagen, dass die Geschichte meiner Bildung da anfängt, wo auch die Geschichte der europäischen Bildung beginnt.
Interview: Gunnar Luetzow